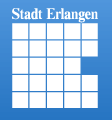1. Mit der vorliegenden Planung
(Anlage 4) ist die Leistungsphase „Vorplanung“ gemäß DA Bau - Abschnitt 5.4
abgeschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiter notwendigen,
vertiefenden Planungsschritte und anschließend die Umsetzung der neuen Wegeverbindung
durchzuführen.
2. Die notwendigen Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung sind bei Referat II zum Haushalt anzumelden.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
![]() Der
zu betrachtende Abschnitt beginnt im Norden südlich der Bahntrasse der
Hafenbahn (ehem. Aurachtalbahn) und endet an der nördlichen Ortseinfahrt von
Eltersdorf (Anlage 1). Im Bestand wird der Radverkehr zum einen im Mischverkehr
geführt, zum anderen ist der Gehweg für den Radverkehr in beide Richtungen frei
gegeben. Im nördlichen Abschnitt der Betrachtung wurden mittlerweile auf beiden
Seiten der Fahrbahn Radschutzstreifen angelegt (Anlage 2).
Der
zu betrachtende Abschnitt beginnt im Norden südlich der Bahntrasse der
Hafenbahn (ehem. Aurachtalbahn) und endet an der nördlichen Ortseinfahrt von
Eltersdorf (Anlage 1). Im Bestand wird der Radverkehr zum einen im Mischverkehr
geführt, zum anderen ist der Gehweg für den Radverkehr in beide Richtungen frei
gegeben. Im nördlichen Abschnitt der Betrachtung wurden mittlerweile auf beiden
Seiten der Fahrbahn Radschutzstreifen angelegt (Anlage 2).
Im Zukunftsplan Fahrradstadt (OBM/002/2021) wird dieser Abschnitt als prioritär bis 2024 umzusetzendes Netzelement aufgeführt. Die Verbindung wird bereits seit langem von Bürger*innen und Ortsbeirat bemängelt. Im Plannetz Radverkehr 2030 (613/249/2019) wird die Verbindung als alternative Radschnellverbindung kategorisiert. Der Bereich des Geh-/Radweges der Brücke über die BAB 3 wurde in Abstimmung mit der Autobahndirektion Nürnberg bereits 2021/22 ausschöpfend optimiert und ist deshalb nicht Bestandteil dieser Planung.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Der Bestand ist aus mehreren Gründen anzupassen:
· Der Ortsteil Eltersdorf besitzt kaum Radinfrastruktur bzw. ein zusammenhängendes Radwegenetz. An das Zentrum Erlangens ist der Radverkehr lediglich über das Gewerbegebiet „Am Pestalozziring“ im Nordosten angebunden. Ein Ausbau der Radinfrastruktur im Ortsteil ist von zentraler Bedeutung für den Alltagsradverkehr, den Schulverkehr sowie den Radpendlerverkehr zwischen Fürth und Erlangen sowie zwischen Nürnberg, Erlangen-Tennenlohe und dem Gewerbegebiet Frauenaurach.
· Die Führung des Radverkehrs entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Der DTVw beträgt in diesem Abschnitt rund 8.800 Kfz/24h und 665 Rad/24h. Die Geschwindigkeit ist auf 50km/h begrenzt. In diesem Fall ist nach den „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) eine vom MIV getrennte Radverkehrsführung anzustreben. Dies ist auf dem bestehenden Gehweg mit „Radfahrer frei“ in beide Richtungen bei einer Breite von 1,30-1,60 m weder richtlinienkonform, noch sicher.
· Der Gehweg entspricht im Bestand nicht den geltenden Richtlinien. Nach den „Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen“ (EFA) sind mind. 2,5 m nutzbare Gehwegbreite umzusetzen.
· Es gibt weder im nördlichen noch im südlichen Bereich des betrachteten Abschnittes eine (barrierefreie) Querungsmöglichkeit für den Fuß- oder Radverkehr.
· Die Lichtsignalanlage für den Fußverkehr an der Haltestelle „Weidenweg“ ist nicht barrierefrei.
· Die an die Fürther Straße angrenzenden Erschließungsstraßen Lindenweg und Weidenweg sind entsprechend ihrer Funktion zu groß dimensioniert und werden demgemäß angepasst. Dadurch werden zum einen die Kreuzungslänge für den Fuß- und Radverkehr erheblich verkürzt und zum anderen eine Fläche von ca. 464 qm entsiegelt sowie vier Bäume neu gepflanzt.
· Die Bussteige der Haltestelle „Weidenweg“ sowie der Haltestelle „Am Kreuzstein“ sind nicht barrierefrei und werden daher barrierefrei ausgebaut. Die Haltestelle „Weidenweg“ erhält im Zuge dessen Fahrradbügel, um die Intermodalität zu fördern.
· Die Beschlüsse des Erlanger Stadtrates zum Klimanotstand, Klimaufbruch, Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplan 2030 sowie Zukunftsplan Fahrradstadt haben die Förderung des Umweltverbundes bzw. des Radverkehrs zum Ziel. Die geplante Maßnahme ist eine infrastrukturelle Umsetzung der Beschlüsse.
· Im Ergebnis muss festgestellt werden, dass die Bestandssituation weder richtlinienkonform, noch verkehrssicher, noch leistungsfähig ist.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Die Verwaltung hat aus den oben genannten Gründen und nach intensiver Prüfung der Möglichkeiten eine Vorplanung (s. Anlage 4) erstellt, die eine Verbreiterung des Bestandsgehweges zum Ziel hat. Zukünftig weist dieser im Verlauf eine Breite von 2,60-2,95 m plus einem Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn mit 0,50 m auf. Ein Ausbau auf Radschnellverbindungsniveau ist aufgrund der Flächenverfügbarkeit nicht möglich. Daher ist die Route nach den Standards als Radvorrangroute, mindestens aber als städtische Hauptroute geplant. Dies ermöglicht eine gemeinsame Führung des Fuß- und Radverkehrs abseits des Kfz-Verkehrs gemäß den geltenden Richtlinien (ERA, RASt, EFA) und Vorschriften (VwV-StVO). Aufgrund der bereits vorhandenen Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h wurden alle Sicherheitsabstände gemäß der Entwurfsgeschwindigkeit 50 km/h geplant. Passive Schutzeinrichtungen sind demzufolge nicht erforderlich.
Der im nördlichen Bereich des betrachteten Abschnitts ankommende und nach Süden verlaufende Radschutzstreifen wird bis zum Lindenweg weitergeführt. Der Radverkehr erhält an dieser Stelle eine Querungshilfe, um den ostseitig verbreiterten Geh/Radweg zu erreichen. Am südlichen Ende der Maßnahme wird eine barrierefreie Mittelinsel zur leichteren Querung für den Fuß- und Radverkehr geplant. Ebenso profitieren Busnutzende von der neuen Querungshilfe, da sie das sichere und einfache Erreichen der Bushaltestelle „Am Kreuzstein“ unterstützt. Zudem stellt die Mittelinsel eine gute Möglichkeit dar, die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs am Ortseingang zu reduzieren.
Zur Reduzierung unnötig langer Kreuzungswege des Fuß- und Radverkehrs werden die Knotenpunkte Lindenweg und Weidenweg gemäß ihrer Funktion optimiert. Dadurch können zeitgleich eine erhebliche Fläche entsiegelt und Baumneupflanzungen gemäß des Erlanger Baumradars realisiert werden. Die vorhandenen Bushaltestellen „Weidenweg“ und „Am Kreuzstein“ werden barrierefrei als Kap ausgebaut. Zusätzliche Fahrradanlehnbügel sollen die intermodale Verknüpfung fördern.
Im Zuge der Maßnahme soll die sehr alte Beleuchtungsanlage erneuert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Die seitlichen Geländerhöhen zwischen Weidenweg und Autobahnbrücke werden geprüft und gegebenenfalls angepasst. Da die Wegeverbreitung in die vorhandene Böschung vorgenommen wird, kann es erforderlich werden Stützwände einzubauen. Zudem wird in der Entwurfsplanung die Fahrbahnentwässerung neu geregelt, da die Fahrbahn bisher nach Osten in die Grünfläche entwässert. Der Baumbestand soll durch geeignete Maßnahmen (z.B. Wurzelbrücken o.ä.) geschützt werden.
Die Maßnahme dient damit der Umsetzung des zugrundeliegenden Plannetzes Radverkehr der Stadt Erlangen, erhöht deutlich die Verkehrssicherheit für Fuß- und Radverkehr und verbessert die Attraktivität des gesamten Umweltverbundes. Zudem kann die Maßnahme durch die Förderung des Umweltverbundes und des Radverkehrs im Speziellen sowie durch Entsiegelung und Neupflanzungen einen Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele der Stadt Erlangen leisten.
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*, integrierte Planung zur Förderung des Umweltverbundes
sowie zur Flächenentsiegelung in den Kreuzungsbereichen mit Baumneupflanzungen
ja, negativ*, Flächenversiegelung durch Inanspruchnahme des schwer zu
pflegenden Grünstreifens entlang der Fahrbahn
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*, die vorhandenen
Zwangspunkte lassen keine andere Lösung zu, die Flächenentsieglung überwiegt
die -versiegelung; die neuen Grünflächen sind wesentlich leichter zu
unterhalten und ermöglichen Baumneupflanzungen
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
|
Investitionskosten: |
ca. 2.150.000,- € |
bei IPNr.: 541.420 „Fürther
Straße von südl. BAB bis Bahnlinie“ |
|
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Korrespondierende Einnahmen |
Derzeit wird vom Zuwendungsgeber, der Regierung von
Mittelfranken, die grundsätzliche Förderfähigkeit der Maßnahme geprüft. |
bei Sachkonto: |
|
|
||
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden und werden zum HH 2024 angemeldet
Anlagen:
Anlage 1 – Räumlicher Umgriff der Maßnahme
Anlage 2 – Fotos Bestandszustand
Anlage 3 – Ausschnitt Plannetz Radverkehr 2030
Anlage 4 – Vorplanung