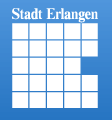hier: BPläne 435 und 436 - Siemens-Campus (Module 1 und 2)
Im Geltungsbereich der Bebauungspläne 435 und 436 (Siemens-Campus Modul 1 und 2) ist die Benennung von Straßen und Wegen erforderlich.
Zuvor ist die Rücknahme der Platzbenennung „Schuckertplatz“ zu beschließen, da der Name innerhalb des Siemens-Campus eine neue Verwendung finden soll.
- Die Benennung
„Schuckertplatz“, gelegen zwischen Werner-von-Siemens-Straße und
Beethovenstraße sowie westlich der Sieboldstraße, wird aufgehoben.
- Die neu entstehenden
öffentlichen Erschließungsstraßen im Geltungsbereich der Bebauungspläne
435 und 436 erhalten die Bezeichnungen:
·
Halskestraße (BPlan 435)
· Schuckertstraße (BPlan 436)
- Der MIV-freie zentrale
Grünzug in West-Ost-Richtung der Bebauungspläne 435 und 436 wird benannt
mit:
· Siemenspromenade
- Die Wege in Nord-Süd-Richtung
werden benannt mit:
·
Wattweg (BPlan 435)
·
Ampèreweg (BPlan 435)
·
Faradayweg (BPlan 435)
·
Meitnerweg (BPlan 436)
·
Sponerweg (BPlan 436)
- Die Physikerin Hedwig Kohn (1887-1964) wird in die Vorschlagsliste für künftige Straßenbenennungen aufgenommen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Die Gemeinden haben gemäß Art. 56 Abs. 2 GO für eine zuverlässige Orientierung im Gemeindegebiet zu sorgen. Dazu tragen Straßen, Wege- und Platznamen, Straßennamensschilder und Hausnummern wesentlich bei. Dadurch wird insbesondere bei Notfällen ein effektiver Einsatz der Rettungsdienste und der Polizei gewährleistet, sowie Zustellungen, Lieferungen und der geschäftliche sowie private Besuchsverkehr erleichtert. Für die Erteilung der Namen ist gemäß Art. 53 Abs. 1 BayStrWG die Gemeinde zuständig.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Die zentrale Haupterschließung des Siemens-Campus in Nord-Süd-Richtung erfolgt über die vorhandene Günther-Scharowsky-Straße. Westlich und östlich dieser Achse und im Norden angrenzend an die Paul-Gossen-Straße entstehen zuerst die Module 1 und 2 des Siemens-Campus. Einerseits wird es neue öffentliche Erschließungsstraßen geben, andererseits Wege und einen prägnanten zentralen MIV-freiem Grünzug, die nicht öffentlich gewidmet werden. Die vorzunehmenden Benennungen erfolgen in Abstimmung mit der Siemens AG.
1.
Aufhebung der Benennung „Schuckertplatz“ (Anlage
1)
Die Namen Schuckert und Siemens sind bereits lange im Straßenverzeichnis der Stadt Erlangen zu finden. Aus Anlass des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Siemens-Schuckert-Werke wurde mit Stadtratsbeschluss vom 25.02.1953 die ehemalige „Ringstraße“ umbenannt in „Werner-von-Siemens-Straße“. Der damals von Siebold-, Beethoven-, Gerstenberg- und Ringstraße umgrenzte und noch unbebaute Platz (westlich „Himbeerpalast“) wurde „Schuckertplatz“ benannt.
Während die „Werner-von-Siemens-Straße“ heute eine der wichtigsten innerstädtischen Straßen darstellt, wurde die seinerzeit vorgesehene Ausgestaltung des Platzes zu einer Grünanlage nie realisiert. Aktuell ist der „Schuckertplatz“ im südlichen Teil mit Bürogebäuden bebaut und wird im nördlichen Teil als Parkplatz für Siemens-Mitarbeiter genutzt.
Die Verwaltung schlägt vor die Benennung des Platzes von 1953 aufzuheben. Einerseits existieren hierzu keine Adressen und andererseits wurde die ursprünglich geplante Gestaltung zur öffentlichen Grünanlage bzw. Platz nie umgesetzt, sondern der Bereich wird aktuell als private Parkplatzfläche genutzt und ist z.T. auch bebaut. Im Hinblick auf die künftig vorgesehene Umnutzung des unmittelbar westlich gelegenen Himbeerpalastes ohne die Fa. Siemens ist die Benennung nach Schuckert an dieser Stelle entbehrlich. So ist es auch Wunsch der Siemens AG die Benennung einer Straße im Siemens-Campus nach Schuckert vorzunehmen, wo der Name dann künftig angemessen gewürdigt wird.
2. Benennung
der Straßen und Wege im Siemens-Campus (Anlage 2)
Es besteht der Wunsch den Namen „Siemens“ im Campus zur Image- und
Identitätsbildung zu platzieren. Um den prägnanten Charakter des MIV-freien
zentralen Grünzuges im Campus herauszustellen wird die Benennung „Siemenspromenade“
vorgeschlagen. Eine Adressbildung an dieser zentralen Benennung sollte aus
Sicht der Verwaltung in jedem Fall stattfinden. Es sind pro Gebäude auch
diverse Adressbildungen (je nach Anzahl und Lage der Eingänge) möglich.
Problemlagen wegen der dann vorhandenen doppelten Benennung mit dem Namen
Siemens in Erlangen („Werner-von-Siemens-Straße“ bzw. „Siemenspromenade“) sind
nach Ansicht der Verwaltung nicht zu erwarten.
Mit dem Namen Werner von Siemens eng verbunden sind auch Georg Halske und Johann Siegmund Schuckert. Auch diese beiden Herren sollen im Siemens-Campus durch eine Straßenbenennung geehrt werden. Dafür vorgesehen sind die beiden öffentlichen Erschließungsstraßen östlich und westlich der Günther-Scharowsky-Straße. Diese Haupterschließungsstraßen werden wie folgt benannt:
·
Halskestraße
(nach Johann
Georg Halske, Mitbegründer der Telegraphen-Bauanstalt Siemens&Halske)
·
Schuckertstraße
(nach Johann
Siegmund Schuckert, Mitbegründer der Siemens-Schuckert-Werke)
Der MIV-freie zentrale und prägnante
Grünzug im Campus in West-Ost-Richtung der Bebauungspläne 435 und 436 wird
benannt mit:
·
Siemenspromenade
(nach Werner
von Siemens; zur Identitäts- und Imagebildung)
Zur Verbesserung der Orientierung im Siemens-Campus schlägt die Verwaltung weiterhin vor, auch einige zentrale MIV-freie Wege (-achsen) in Nord-Süd-Richtung zu benennen. Die Vorschläge für Modul 1 basieren z.T. auf dem Vorschlagskonzept der Siemens AG vom Januar 2016, in dem die auf dem Areal bisher internen und nicht offiziell benannten Wegebenennungen aufgegriffen wurden.
·
Wattweg
(James Watt, schottischer
Erfinder und Mechaniker)
·
Ampèreweg
(Andre-Marie
Ampère, franz. Physiker u. Mathematiker)
·
Faradayweg
(Michael
Faraday, engl. Naturforscher u. Experimentalphysiker)
Im Bereich von Modul 2 wird auf die Namen von 2 Wissenschaftlerinnen zurückgegriffen. Hier wird insbesondere dem Gender Mainstreaming - Gedanken Rechnung getragen, um den Anteil von Benennungen nach Frauen zu erhöhen:
·
Meitnerweg
(Lise (Elise)
Meitner, österr. Kernphysikerin)
·
Sponerweg
(Hertha Sponer, dt.
Physikerin)
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
Generell soll in der Stadt Erlangen bei der Benennung nach Personen der „Gender Mainstreaming“ – Gedanke entsprechende Würdigung finden. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit sind Straßenbenennungen nach Frauen zu berücksichtigen.
Im Einvernehmen mit der Siemens
AG sollten zunächst im ersten Bauabschnitt des Siemens Campus Benennungen nach
Personen aus der Zeit der Firmengründung Verwendung finden. Recherchen in der
Verwaltung haben hierzu keine adäquaten Namensvorschläge nach Frauen ergeben.
Auch Siemens selbst hat nach weiblichen Vorschlägen gesucht. In der Rückmeldung
der Siemens AG (Real Estate - Siemens Campus) heißt es:
„Zu Zeiten der Firmengründung … waren Geschäft und Wissenschaft eine noch
überwiegend männliche Domäne. Daher konnten wir leider keine passenden Frauen
bzw. Naturwissenschaftlerinnen finden, die … einen Bezug zu Siemens haben.“
Wie in der 5. Sitzung 2017 des ÄR gefordert, wurde deshalb die Recherche nach geeigneten Frauen auf bedeutende Wissenschaftlerinnen ausgedehnt: Lise Meitner, Hertha Sponer und Hedwig Kohn gehören zu den einzigen drei Frauen, die vor dem 2. Weltkrieg in Deutschland eine Habilitation in Physik erreichten. Allen drei Frauen – ganz gleich welcher religiösen Zugehörigkeit und Herkunft – wurde es nach 1934 erschwert bzw. verboten, in ihrem Beruf weiterzuarbeiten. Daher mussten sie aus Deutschland fliehen oder ins Ausland emigrieren, um ihrem Beruf weiter nachgehen zu können.
Lise Meitner (1878-1968): Die Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts wurde protestantisch erzogen und 1908 in die evangelische Kirche aufgenommen. 1901 begann sie mit dem Studium der Physik an der Universität Wien. Bereits in den ersten Jahren beschäftigte sie sich mit Fragestellungen zur Radioaktivität. Nach ihrer Promotion im Jahr 1906 wechselte sie an die Freie Universität Berlin. Dort lernte sie Otto Hahn kennen, mit dem sie in den folgenden 30 Jahren zusammenarbeitete. 1922 habilitierte sie und bekam dadurch das Recht als Dozentin zu arbeiten. 1926 wurde sie außerordentliche Professorin für experimentelle Kernphysik an der Universität Berlin und somit zu Deutschlands erster Physikprofessorin überhaupt. Nachdem man ihr 1933 die Lehrtätigkeit aufgrund ihrer Abstammung entzogen hatte, konnte sie ihre Arbeiten nur an einem nicht staatlichen Institut fortsetzen. Sie blieb jedoch ständig in Kontakt zu ihrem Freund Otto Hahn. 1939 veröffentlichte sie mit ihrem Neffen Otto Frisch die erste physikalisch-theoretische Erklärung für die Kernspaltung. Hahn erhielt 1945 den Nobelpreis für Chemie. Lise Meitner, die den Prozess physikalisch erklärt hatte, blieb unberücksichtigt.
Lise Meitner beobachtete die Verwendung der Kernenergie für Waffensysteme äußerst kritisch. Bis zu ihrem Tod machte sie sich für eine friedliche Nutzung der Kernspaltung stark.
Ihr Leben lang forschte sie und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zu den Themen Radioaktivität, sowie Alpha- und Betastrahlen. Das chemische Element Meitnerium wurde 1997 nach ihr benannt. Ebenso ist sie Namensgeberin des Hahn-Meitner-Instituts für Kernforschung in Berlin. Ferner gibt es eine Anzahl an Preisen für wissenschaftliche Forschungen, die nach Lise-Meitner benannt sind.
Hertha Sponer (1895-1968): Über Umwege gelangte sie zum Abitur, das ihr die Möglichkeit eines Studiums der Physik ermöglichte. Sie promovierte 1920 in Göttingen und wurde 1932 zur außerordentlichen Professorin ernannt. Eine ordentliche Professur war zu dieser Zeit in Deutschland undenkbar. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sah sie keine weitere Perspektive für sich in Deutschland. Daher emigrierte sie zunächst nach Norwegen, später in die USA. Hertha Sponer leistete wichtige Beiträge zur Molekühlphysik und Spektroskopie. Nach ihr ist auch der Hertha-Sponer-Preis benannt, der alljährlich an junge, wissenschaftlich erfolgreiche Physikerinnen von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) in Bad Honnef vergeben wird.
Hedwig Kohn (1887-1964): Sie begann 1906 zunächst als Gasthörerin zu studieren. Nach erfolgreicher Promotion 1913 wurde sie Assistentin am Physikalischen Institut der Universität Breslau, später Privatdozentin. Als 1933 alle jüdischen Wissenschaftler/innen entlassen wurden, emigrierte sie in die Schweiz, später in die USA. Dort wurde sie 1948 zur ordentlichen Professorin ernannt. 1952 wechselte sie an die Durham University in North Carolina, wo auch Hertha Sponer arbeitete. Ihr Spezialgebiet war die Optik. Sie arbeitete aber auch an Verfahren der Pyrometrie und Spektrometrie, sowie der Entwicklung von Lichtquellen.
Der Gedanke der Geschlechtergerechtigkeit kann für den Siemens Campus allerdings nicht, wie in der 5. Sitzung 2017 des ÄR angeregt, auf den Transgender-Bereich ausgedehnt werden. Hierzu finden sich posthum keine geeigneten Personen.
Die Benennungen erfolgen gemäß den Grundsätzen des „Leitfadens für Straßenbenennungen“ (UVPA-Beschluss vom 16.11.2010).
Die vorherige Aufnahme der Namen in die Vorschlagsliste – wie üblicherweise vorgesehen – wird hier ausgesetzt und stattdessen zuvor im Ältestenrat beraten.
Die Benennung wird direkt mit
Beschlussfassung wirksam. Die Umsetzung vor Ort (Anbringen/Aufstellen der
Schilder) erfolgt zu gegebener Zeit durch die Verwaltung in Abstimmung und zu
Lasten des Vorhabenträgers (Regelung gemäß der Städtebaulichen Verträge).
Die Physikerin Hedwig Kohn wird für eine spätere Verwendung in den folgenden Modulen des Siemens Campus in die Vorschlagsliste aufgenommen.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
|
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
|
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
|
||
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Anlage 1: Lageplan zur Aufhebung der Benennung „Schuckertplatz“
Anlage 2: Lageplan zu den Benennungen in den BPlänen 435 und 436