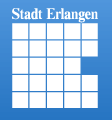Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Inklusion als Gesellschaftsziel für Bildung, Kultur
und Demokatie
Inklusion bedeutet wörtlich den Einschluss jedes Menschen in die Gesellschaft. Sie zielt darauf, individuelle Unterschiedlichkeiten wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne daraus Unterschiede im Maß der gesellschaftlichen Teilhabe abzuleiten. Inklusion ist damit im Kern die soziale Komponente der Demokratie.
In der Geschichte haben sich zahlreiche Formen der Exklusion entwickelt, bei denen Menschen, die dem homogenen Gesellschaftsbild nicht entsprachen, einfach ausgeschlossen wurden.[1] Bei der Exklusion größerer, in sich homogener Gruppen konnten so Parallelgesellschaften entstehen, die möglicherweise mit der „Hauptgesellschaft“ in konkreten Beziehungen verbunden waren, jedoch ihr eigenes Lebens- und Wertesystem in separierten Wohnbereichen entwickelten (Separation).[2] Die gegenwärtig dominierende Auffassung von der Struktur unserer Gesellschaft ist die der Integration, bei der segregierte und als segregiert identifizierte Gruppen in die Hauptgesellschaft aufgenommen werden. Soweit sie dabei ihre eigene Identität behalten, bleiben sie jedoch in der Aufnahmegesellschaft ein Fremdkörper, der z.T. als Bereicherung[3], oft jedoch auch als Störfaktor[4] empfunden wird. Auch eine Verengung des Inklusionsbegriffs auf die Rolle von Behinderten, die diese damit als Sondergruppe beschreibt und lediglich nach Wegen sucht, ihnen den Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtungen zu erleichtern, kommt letztlich – trotz der Verwendung des Wortes „Inklusion“ -. nicht über einen integrativen Ansatz hinaus.
Inklusion fordert dem gegenüber die Gleichwertigkeit und Chancengleichheit jedes Individuums, ohne dass dabei Normalität oder eine Annäherung an eine (von der Mehrheit gesetzte) Normalität angestrebt wird. Inklusion ist deshalb ein wertegestütztes Bekenntnis zur Individualität und zur Diversität der Gesellschaft. Sie beinhaltet die Vision einer heterogenen Gesellschaft mit gleichen Teilhabemöglichkeiten und prinzipieller Bedürfnisbefriedigung für alle. Sie erfordert deshalb – in Abweichung zur derzeitigen Praxis – vor allem die Aufhebung der Schranken durch soziale, ethnische und geistig-körperliche Segregation.
Inklusion in diesem umfassenden Sinn ist nicht Teil der international verbindlichen Vereinbarungen. Deshalb stehen in der praktischen Diskussion meist lediglich die Konsequenzen aus der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) im Zentrum, die 2006 beschlossen wurde. Im Bildungsbereich hat die BRK weitreichende Folgen, ohne dass es jedoch über deren Reichweite Konsens gäbe. Zudem widerspricht die Fokussierung auf Behinderte letztlich dem Inklusionsgedanken, da sowohl die Konvention als auch die sich darauf berufenden Empfehlungen des „Forums behinderte Menschen in Erlangen“ nicht von individuellen Bedürfnissen ausgehen, sondern Ansprüche als gesonderte Gruppe erheben. Dies entspricht eher dem klassischen Integrationsgedanken als dem der Inklusion.
Im Bereich der frühkindlichen Bildung sind – in Bayern seit 2005 auch durch das BayKiBiG – wesentliche Weichen gestellt, indem die Aufnahme Behinderter in Regelkindertageseinrichtungen die Grundannahme bildet und die Finanzierung die Bildung kleinerer Gruppen ausdrücklich berücksichtigt, wenn Kinder mit besonderem Förderbedarf vorhanden sind. Die Schule tut sich vor allem in Ländern wie Deutschland schwerer, in denen ein hohes Maß an Spezialisierung und Separation Merkmal der Schulstruktur ist. Dabei können sich nicht nur die tradierten Strukturen und deren ideologische Basis sich als Inklusionshemmnis erweisen, sondern auch die Sonderinteressen des pädagogischen Fachpersonals und der Wille der Eltern. In dieser Tradition hält besonders der Freistaat Bayern immer noch an seinem auf Separation und Selektion ausgerichteten Schulsystem fest.
Valide Untersuchungen über die Auswirkungen des gemeinsamen Schulbesuchs aller Kinder liegen nur wenig vor. Einzelne Studien zeigen jedoch, dass für Kinder mit Lernbehinderung oder Hörschädigung der Schulerfolg in einer Spezialschule etwas besser ist.[5] Gravierender ist die empirisch gestützte Feststellung, dass die Zusammenfassung in gemeinsamen Lernsystemen oft zu einer Ausdifferenzierung in Subsysteme innerhalb der Struktur führen, so dass in der gemeinsamen Einrichtung informelle Exklusionsbereiche entstehen, die Stigmatisierung verstärken.[6] Dies macht deutlich, dass sich Inklusion nicht auf Strukturentscheidungen beschränken kann, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf die Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals hat. Die inklusive Annahme, dass alle Pädagogen im Prinzip alle Kinder erziehen und unterrichten können, entspricht jedenfalls kaum unserer Bildungswirklichkeit.[7]
Der Deutsche Städtetag begrüßt das Ziel der Inklusion ausdrücklich, weist jedoch ebenfalls deutlich darauf hin, dass angesichts dieser Dimensionen die Kommunen nicht alleiniger Akteur des Prozesse sein können. Nicht nur die Qualifikation, auch die barrierefreie Gestaltung von Kindertageseinrichtungen, Kulturgebäuden und Schulen, die Ausstattung mit geeigneten Materialien sind nach Auffassung des Städtetags konnexitätsrelevante Aufwendungen. „Wenn dieser Schutzmechanismus für die Kommunen ausgehebelt wird, ist auch eine gelingende Inklusion … in Gefahr. Deshalb fordern wir die Länder auf, die Behindertenrechtskonvention verfassungsgemäß umzusetzen“, erklärt die Vizepräsidentin des Deutschen Städtetags, Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth. Allerdings ist die Bayerische Staatsregierung von der Akzeptanz dieser Verantwortung noch weit entfernt. So hält Kultusminister Spaenle die Gesetzgebung zur Inklusion, die der Landtag im Juli verabschiedet hat, bereits für einen „Meilenstein, um die Chancengleichheit von Menschen mit und ohne Behinderung maßgeblich zu verbessern“[8], doch weist der Deutsche Städtetag deutlich darauf hin, dass dieses Gesetz „keine Finanzierung für die zusätzlichen Aufgaben und das notwendige Personal beinhalte“.[9]
Prinzipiell stellt sich die Situation bei den Kultureinrichtungen ähnlich dar, wie im Kernbereich der Bildung. Angebote in Gebärdensprache, Texte in größerer Schrift und Hinweise auf die Barrierefreiheit von Veranstaltungsräumen sind zwar wichtig und hilfreich, bleiben jedoch hinter den weit gesteckten Erwartungen zurück. In vielen Fällen steht schon die Unterbringung kultureller Einrichtungen in historischen Gebäuden einer leichten und auch finanziell tragbaren Umsetzung der Barrierefreiheit im Weg. Auch für die Inklusion von Menschen aus anderen Bereichen, denen der Zugang zu Kultureinrichtungen schwer fällt, fehlen bislang umfassende Konzepte. Dabei werden allerdings – etwas abweichend vom strengen Inklusionsbegriff – die Maßnahmen zunächst auf identifizierbare Gruppen Benachteiligter zu richten sein, da eine zu große Handlungsdiversität dem Fortschritt der Entwicklung nicht dienlich wäre.
Zu den Ansätzen, die bisher in Erlangen diskutiert wurden, gehört das Konzept für einen „Erlangen Pass“, der Benachteiligten einen leichteren Zugang zu Kultureinrichtungen ermöglichen soll. Die Abgrenzung der Berechtigten sollte allerdings unter dem Inklusionsaspekt noch einmal diskutiert und ggf. ausgeweitet werden. Ein anderer Ansatz fordert die verstärkte Beschäftigung von Migranten. Freilich weisen manche Fachleute darauf hin, dass auch diese Forderung dem Inklusionsgedanken widerspricht, da eine „Migrantenquote“ in der öffentlichen Verwaltung eher als Maßnahme gesehen werden muss, die zwar auf die Bedürfnisse einer Sondergruppe eingehen will, sie aber gerade dadurch als solche stabilisiert. Weit eher komme es auf eine Sensibilisierung aller Beschäftigten gegenüber den Bedürfnissen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger – und damit eben auch der Migranten – an.[10] Allerdings ist gerade für Kultureinrichtungen im Rahmen der kulturellen Diversität der Stadt grundsätzlich sinnvoll und erstrebenswert, Migranten einzubeziehen, um deren sprachliche und kulturelle Kompetenz bei der Gestaltung und Vermittlung von Kultureinrichtungen zu nutzen.
Entsprechend der Aufforderung im Kultur- und Freizeitausschuss vom 5. Oktober 2011 legt das Kulturreferat eine von den Ämtern des Referatsbereichs erstellte Übersicht vor, die aufzeigt
1. welche Maßnahmen von den Ämtern und Einrichtungen bereits in der Vergangenheit umgesetzt wurden
2. welche Maßnahmen bis Anfang 2012 mit vorhandenen Mitteln umgesetzt werden sollen und
3. welche Maßnahmen zur Verbesserung der Inklusion behinderter Menschen notwendig wären, ohne zusätzlich Finanzmittel jedoch nicht umsetzbar sind.
Bei allen Maßnahmen ist jedoch der Hinweis wichtig, dass sie lediglich als Schritte im Rahmen eines langen, nachhaltigen Prozesses zu sehen sind. Zudem ist eine Klärung sowohl des Inklusionsbegriffs als auch der Möglichkeiten kommunalen Handelns notwendig, um einen Konsens für die Entwicklung von Inklusion in Erlangen zu finden.
[1] Dazu gehört z.B. der Umgang der mittelalterlichen Kirche mit Ketzern.
[2] Ein bekanntes Beispiel dafür sind die jüdischen Ghettos in mittelalterlichen Städten.
[3] z.B. im Bereich der Gastronomie
[4] so häufig im Wohnumfeld, im Freizeitverhalten oder in Schulen
[5] World Health Organization: World Report of Disability, Genf 2011, S. 211
[6] Ingeborg Hedderich, André Hecker: Belastung und Bewältigung in Integrativen Schulen, Bad Heilbrunn / Klinkhardt, 2009, S 39 f
[7] So werden in Südtirol nicht Schüler mit Auffälligkeiten in besonderen Schulen oder Klassen gesammelt und damit dort gehäuft. Stattdessen besuchen die Kinder mit Besonderheiten die Schule ihrer Wahl (oder die ihrer Eltern) und verteilen sich so auf prinzipiell alle Schulen und Klassen ohne gesonderte Steuerung von außen. Somit befindet sich in der Regel kaum mehr als ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf in einer Klasse. Ist dies der Fall, wird nach Erkundung der Ursachen durch Diagnoseverfahren und Gespräche ein individueller Erziehungsplan erstellt, bei dem sowohl das Kind als auch die Lehrkraft Unterstützung durch „Integrationslehrer“ erhält. Die bedeutet für die Lehrkraft zwar eine besondere Herausforderung, aber nicht unbedingt eine besondere Belastung. (So jedenfalls eine Referentin aus dem Südtiroler Schulamt auf der 3. Nürnberger Bildungskonferenz am 21. Okt. 2011.)
[8]
[9] Mitteilungen des Deutschen Städtetags, Okt. 2011
[10] so Halit Öztürk vom Institut für Pädagogik der FAU Erlangen-Nürnberg auf der 3. Bildungskonferenz der Stadt Nürnberg am 21. Okt. 2011
Anlagen:
Tabellarische Auflistung der in den Kulturfachämtern von Referat IV bereits umgesetzten und kurzfristig möglichen Maßnahmen sowie weiter mögliche Maßnahmen bei entsprechen finanzieller Ausstattung